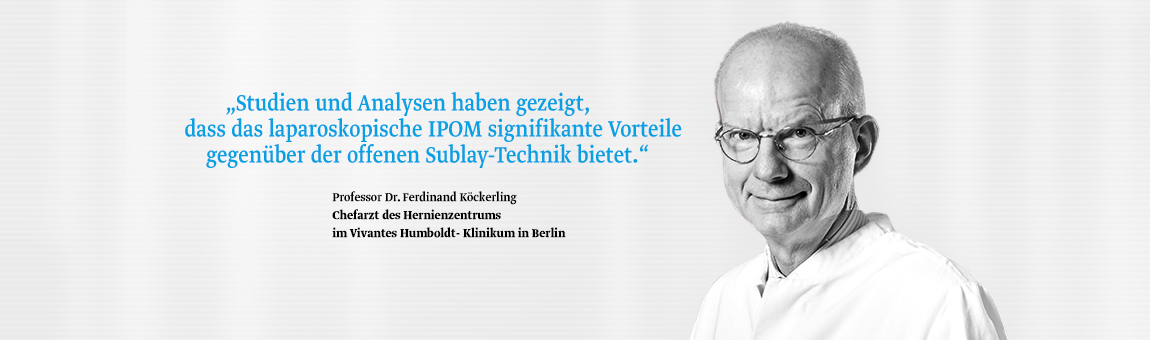Professor Dr. Ferdinand Köckerling im Gespräch über IPOM und den Einsatz titanisierter Netzimplantate
Was verbirgt sich hinter der laparoskopischen IPOM-Technik? Bei welchen Arten von Hernien kommt dieses Verfahren zum Einsatz?
Die laparoskopische intraperitoneale Onlay-Mesh-Technik ist ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung von primären Bauchwandhernien (Nabelhernie, epigastrische Hernie), sowie von Narbenhernien. Hierbei wird ein Netzimplantat zum Verschluss des Bauchwanddefektes von innen über die betroffene Stelle ausgebreitet und mit transfaszialen Nähten und Tackern fixiert. Unter Anwendung des laparoskopischen IPOM-Verfahrens können gute Ergebnisse erzielt werden – mit geringem Risiko für postoperative Komplikationen.
Welche weiteren Behandlungstechniken gibt es für die Versorgung solcher Hernien?
Neben dem bereits beschriebenen laparoskopischen IPOM-Verfahren kann die offene Sublay-Technik sowohl für die Versorgung primärer als auch sekundärer Bauchwandhernien angewandt werden. Diese Technik liefert im Vergleich mit allen anderen offenen OP-Techniken die besten Ergebnisse. Eine Optimierung dieser offenen OP-Techniken kann zusätzlich noch durch die Mini/Less Open Sublay Technik (MILOS) aufgrund des reduzierten Zugangsweges erreicht werden.
Welche Vorteile besitzt die laparoskopische IPOM-Technik gegenüber anderen Operations-Verfahren? Sind bei der Verfahrenswahl spezielle Kriterien auf Basis der Klassifikation der Hernie zu beachten?
Große Registerstudien und Metaanalysen haben gezeigt, dass das laparoskopische IPOM signifikante Vorteile gegenüber der offenen Sublay-Technik bietet 1. Durch den minimalinvasiven Eingriff lässt sich das Risiko einer postoperativen Wundkomplikation deutlich verringern 1. Somit stellt die laparoskopische IPOM-Technik evidenzbasiert zum jetzigen Zeitpunkt den Goldstandard in der Versorgung von Narbenhernien bis zu einer Defektgröße von 8 - 10 cm dar. Der Vorteil des laparoskopischen IPOM besteht in einer sehr niedrigen Wund- und Netzkomplikationsrate von etwa 1 - 3 %. In der offenen Narbenhernienchirurgie muss man in etwa 10 % der Fälle mit einer Wund- bzw. Netz-Infektion rechnen. Auch in einer 5-jährigen Nachbeobachtung im dänischen Hernienregister fand sich für das laparoskopische IPOM keine höhere Netz-Komplikationsrate als für die offene Narbenhernienchirurgie 2. Dennoch belegen neuste Registerdaten, dass diese Vorteile des IPOM-Verfahrens nur bei Defekten bis max. 10 cm bestehen 3. Gleichermaßen wird in den Guidelines der International Endohernia Society empfohlen, die laparoskopische IPOM-Technik nur bis zu einer Defektbreite von max. 8 - 10 cm anzuwenden und die Bruchstelle nach Möglichkeit zu verschließen 4.
Welche Netzimplantate kommen bei der IPOM-Technik zum Einsatz? Wie muss das ideale Netz zur intraperitonealen Versorgung beschaffen sein?
Das ideale Netzimplantat für den intraperitonealen Einsatz muss auf der Bauchwandseite optimal einwachsen und zum Bauchraum hin das Risiko von Adhäsionen minimieren. Dementsprechend scheiden reine Polypropylen- oder Polyester-Netze aus – diese müssen zum Bauchraum hin zusätzlich mit resorbierbaren oder permanenten Materialien überzogen sein, die eine hohe Gewebeverträglichkeit aufweisen. In der intraperitonealen Hernienversorgung werden also Netze eingesetzt, die einseitig mit einer permanenten oder resorbierbaren Schutzschicht überzogen sind, und solche, die komplett titanisiert sind. Für diese Materialien ist bekannt, dass sie das Ausmaß der Adhäsionen reduzieren können 5.
Zu welchen postoperativen Komplikationen kann es nach dem Einsatz eines Netzimplantates kommen? Welche Folgen kann das konkret für Patienten haben?
Adhäsionen, bei denen es zu Verwachsungen zwischen dem Netzimplantat und der Darmwand kommt, können im weiteren Verlauf zu einer schwerwiegenden Komplikation führen, die nach dem Einsatz des Implantats entstehen kann. Postoperativ kann es in der Hernienversorgung darüber hinaus zu Infektionen der Operationsstelle kommen, sowie zu Seromen oder Blutungen, die Nachoperationen notwendig machen.
Sie setzen im Praxisalltag auf titanisierte Polypropylen-Netze. Welche Vorteile haben solche Netze beim laparoskopischen IPOM?
Die titanisierten Netze zeigen im chirurgischen Alltag erhebliche Vorteile.Beim laparoskopischen IPOM können sie problemlos über den Trokar in den Bauchraum eingebracht werden. Da das Netz komplett titanisiert wird, ist eine Verwechslung der Seiten nicht möglich. Die titanisierten Netze sind hydrophil; sie lassen sich somit leicht an die Bauchwand modellieren und haften gut an. Die anschließende Fixierung kann problemlos erfolgen. Durch die hydrophile Oberfläche wird das Netzimplantat zusätzlich besser von körpereigenen Zellen angenommen, was das Einwachsen in der Bauchwand erleichtert. Die titanisierten Netze können mit jedem [medizinischen - Anm. pfm medical] Tacker an die Bauchwand fixiert werden. Transfasziale Nähte an den vier Ecken des Netzes werden nur zur optimalen Platzierung über dem Defekt benötigt. Auch nach dem Defektverschluss lässt sich aufgrund der großporigen Struktur die Anatomie hinter dem Netzimplantat gut erkennen. Titanisierte Netze zeichnen sich somit beim laparoskopischen IPOM durch optimale Handling-Eigenschaften aus.
Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die den hohen Patientennutzen titanisierter Netzimplantate beim IPOM-Verfahren belegen?
Anhand von mehreren Registerstudien und einer randomisierten kontrollierten Studie konnte belegt werden, dass titanisierte Netzimplantate die hohen Erwartungen zum Nutzen der Patienten voll und ganz erfüllen 6.
(Juni 2019)
- Köckerling F., Simon T., Adolf D., Köckerling D., Mayer F., Reinpold W., Weyhe D., Bittner R., Laparoscopic IPOM versus open sublay technique for elective incisional hernia repair: a registry-based, propensity score-matched comparison of 9907 patients., SurgEndosc. 2019, 33(10):3361-3369.
- Kokotovic D, Bisgaard T, Helgstrand F, Long-term recurrence and complications associated with elective incisional hernia repair. JAMA 2016, 316: 1575-1582
- Köckerling F, Simon T, Hukauf M et al., The Importance of Registries in the Postmarketing Surveillance of Surgical Meshes. Ann Surg 2018, 268: 1097-1104
- Bittner, R., Bingener-Casey, J., Dietz, U. et al., Guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias (International Endohernia Society [IEHS]) - Part I. Surg Endosc. 2014, 28(1): 2-29.
- Schug-Paß C., Tamme C., Tannapfel A., Köckerling F., A lightweight polypropylene mesh (TiMesh) for laparoscopic intraperitoneal repair of abdominal wall hernias: : comparison of biocompatibility with the DualMesh in an experimental study using the porcine model., Surg Endosc. 2006, 20(3): 402-409.
- Moreno-Egea A., Carrillo-Alcaraz A., Soria-Aledo V., Randomized clinical trial of laparoscopic hernia repair comparing titanium-coated lightweight mesh and medium-weight composite mesh. Surg Endosc, 2013. 27(1): p. 231-239
Unser Gesprächspartner
Professor Dr. Ferdinand Köckerling ist Chefarzt des Hernienzentrums im Vivantes Humboldt-Klinikum in Berlin.